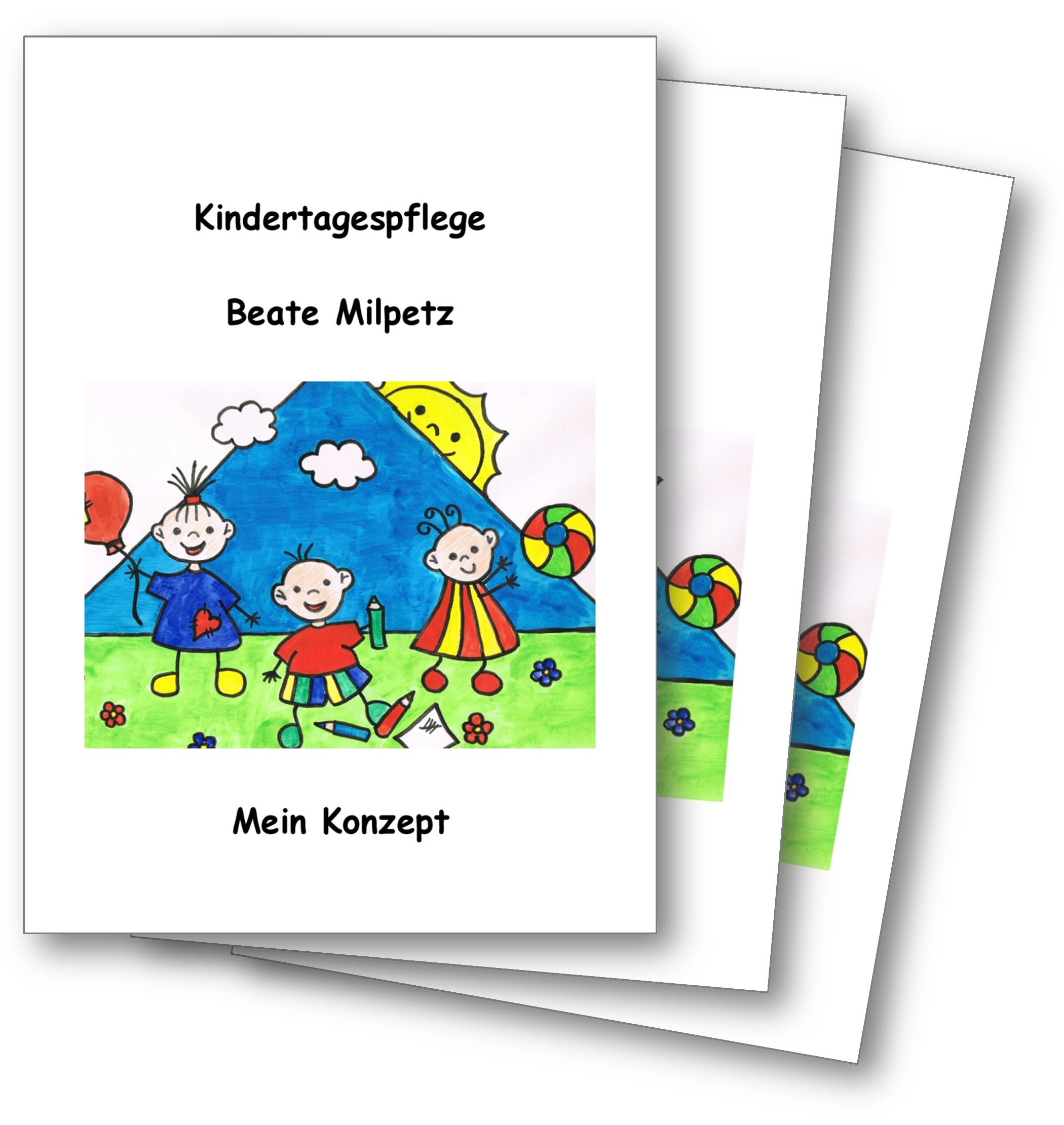Kindertagespflege
Mein Konzept
|
|
Pädagogik
Ich unterstütze das Kind in seiner Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, befähige es zu Verantwortungsbereitschaft, Gemeinsinn und Toleranz und unterstütze und ergänze die Eltern in einer Erziehungspartnerschaft, um Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können. (Siehe auch KiBiz §13)Der §22 (3) SGB VIII formuliert den Förderauftrag einer Tagespflegeperson:
Dieser umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen.
1. Erziehung
Jedes Kind ist in seinem Wesen, seiner Entwicklung und seiner Art zu lernen einzigartig. Deshalb hole ich das Kind dort ab, wo es sich in seiner Entwicklung befindet, fördere und begleite es durch den Alltag, ohne es dabei zu überfordern oder aber in seiner wachsenden Selbständigkeit einzuschränken. Erziehen bedeutet für mich, das kindliche Verhalten zu lenken. Ethische und moralische Werte werden vermittelt, Kontakt- und Konfliktfähigkeit gefördert. Als Tagesmutter bin ich verlässlich und authentisch und in meinem Handeln ein Vorbild für das Kind. Ich setze gewaltfrei klare Grenzen und Konsequenzen, was mich für das Kind berechenbar macht. Dabei sollen so wenig Regeln wie möglich, aber so viele wie nötig dem Kind neben einem strukturierten Alltag den nötigen Freiraum geben, seine Individualität und seine Vorlieben und Fähigkeiten zu entdecken. Verlässliche Abläufe und wiederkehrende Rituale im Alltag geben dem Kind Sicherheit. Es kann sich daran orientieren, sich darauf einstellen und Vorfreude entwickeln. Ich trete in Interaktion mit dem Kind und gebe ihm wertschätzende Rückmeldungen. Außerdem nehme ich die Bedürfnisse des Kindes wahr und reagiere angemessen darauf. Das Kind lernt durch den täglichen geschwisterähnlichen Umgang mit gleichaltrigen, aber auch jüngeren und älteren Kindern im Alltag wichtige soziale Kompetenzen wie Kontakt- und Konfliktfähigkeit, Toleranz und Rücksichtnahme und das Suchen und Finden eigener und gemeinsamer Lösungen.
2. Bildung
Durch meine langjährige Erfahrung als Übungsleiterin im Eltern-Kind-Turnen und in Sportgruppen für Kinder bis ins Grundschulalter ist mir die Förderung der motorischen Fähigkeiten besonders wichtig. Bewegung gehört zu den elementaren Ausdrucksformen des Kindes. Durch Bewegung und Spiel setzt das Kind sich mit seiner Umwelt auseinander und entdeckt so die Welt und sich selbst. So ist der Körper das Mittel zur Entdeckung des „Ich“ und der Selbständigkeit, angefangen beim Robben bis hin zum selbständigen Laufen, welches den Handlungs- und Erfahrungsspielraum des Kindes zunehmend erweitert. Das Kind soll durch die Freude an der Bewegung dazu befähigt werden, sich mit sich selbst, mit anderen und mit den räumlichen Gegebenheiten, dem vorhandenen Material und seiner Umwelt auseinander zu setzen. Es erwirbt dabei nicht nur motorische, sondern auch personale, soziale und kognitive Kompetenzen. Das Kind sammelt durch seinen Körper und die Bewegung Erfahrungen über sich selbst, es lernt sich einzuschätzen und gewinnt Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Dies sind Voraussetzungen für den Aufbau eines positiven Selbstkonzeptes. In der Bewegung setzt das Kind sich außerdem mit seiner Umwelt auseinander und lernt z.B. physikalische Gesetzmäßigkeiten. Das Kind nimmt in Bewegung Kontakt mit anderen auf, es spielt mit und gegen die anderen, handelt Regeln aus und nimmt unterschiedliche Rollen ein. Dadurch erfährt es elementare Regeln des sozialen Zusammenlebens, es lernt, seine Wünsche und Bedürfnisse zum Ausdruck zu bringen, genauso wie die Wünsche anderer zu berücksichtigen und auf diese einzugehen. Eine positive Wirkung auf die Motorik und die alltagsinegrierte Sprachförderung hat das Spiel. Es schafft vielfältige Bewegungs- und Sprechanlässe und hat meist einen hohen Aufforderungscharakter. Es ermöglicht dem Kind, sowohl seinen Körper und seine Bewegung, als auch seine Sprache und Stimme einzusetzen und fördert so nicht nur die Handlungs- sondern auch die Kommunikations- und Interaktionsfähigkeit. Auf dieser Grundlage lasse ich dem Kind viel Zeit und Raum zum spielen und sich zu bewegen, drinnen und draußen, mit und ohne Material, so dass es dem Kind möglich ist, in einen Selbstbildungsprozess zu gelangen. Ich bin Begleiterin und Forschungsassistentin und setze, wenn nötig, Impulse, um Bildungsprozesse auszulösen. Solche Impulse können z.B. immer wiederkehrende Bewegungslieder sein. Manchmal reicht aber auch das bereitstellen von Material, sei es Spiel- oder Bastelmaterial oder ein Alltagsgegenstand, den es zu erforschen gilt, das Aufschlagen eines Buches zum Vorlesen oder erzählen, oder das gemeinsame Rausgehen in die Natur als nötiger Impuls. Sowohl im freien Spiel als auch im ritualisierten Alltag gebe ich den Kindern die Möglichkeit der Partizipation. In der Regel darf das Kind selber entscheiden, was es spielen möchte. Alle Spielsachen sind in offenen, halbhohen Regalen für die Kinder frei zugänglich; Fahrzeuge, das Spielhaus mit Versteckmöglichkeiten, ein Bällebad und ein Kletterdreieck mit Schaukel und Rutschbrett sind jederzeit bespielbar. Wenn wir gemeinsam den Tisch decken, kann es sich das Besteck aussuchen: ich lasse dem Kind immer die Wahl zwischen zwei Besteck-Farben, so dass es eine „entweder / oder“-Entscheidung treffen kann, ohne dabei überfordert zu werden. Ein weiteres Beispiel für die Partizipation sind die Betten zum Ruhen: da diese nur etwa 20 cm hoch sind, kann selbst das Krabbelkind nach dem Wachwerden eigenständig das Bett verlassen und so selber entscheiden, wann es aufstehen möchte. So erfährt das Kind immer wieder Selbstwirksamkeit und wird befähigt, eigenverantwortlich Entscheidungen zu treffen.